Geschichte
Die Gründung der Burg im 13. Jahrhundert durch die Schenken zu Erbach lässt sich
aus den mittelalterlichen Besitzverhältnissen erschließen. Ersterwähnung des
Schlosses (ortsübliche Bezeichnung im Sinne von Festung) 1297. Die nach ihm
benannten Herren von Freienstein waren Burgmannen der Erbauer. Ihnen diente der
stark gesicherte Wehrbau mit seiner Mannschaft zur Überwachung und notfalls zur
Abriegelung der den Gammelsbach begleitenden Straße aus dem Neckartal bei
Eberbach nach dem inneren Odenwald um Michelstadt. Die Burg war zugleich ein
Verwaltungssitz für 15 Dörfer einschließlich Beerfelden.
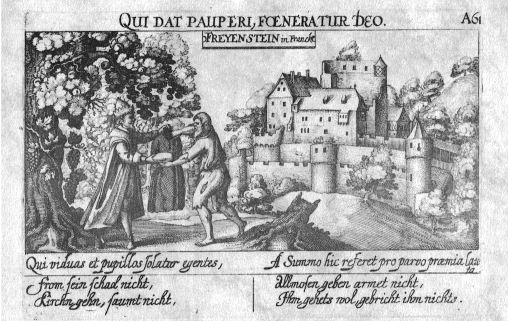
Burg Freienstein frühes 13. Jahrhundert.
Kupferstich aus Kieser-Meissners Schatzkästlein 1627.
Dieses Gebiet des späteren Amtes Freienstein der Grafschaft Erbach hatte bis um
1035 zur Reichsabtei Lorsch gehört, die Bauern ansiedelte und im 12. Jahrhundert
den Heidelberger Pfalzgrafen Konrad, den Bruder Kaiser Friedrichs Barbarossa,
als mächtigen Obervogt und zur Ausübung der Gerichtsbarkeit einsetzte. Seinen
Nachfolgern aus dem bayrischen Herzogshaus Wittelsbach war vor 1232 der einstige
Klosterbesitz um Beerfelden zugefallen. Als deren Lehensträger konnten die
Schenken zu Erbach dort den Südrand ihrer Herrschaft von Freienstein aus
schützen lassen. Um 1300 stritten die Erzbischöfe von Mainz jahrzehntelang mit
den Pfalzgrafen um das Lorscher Erbe im Odenwald. Die Erbacher Schenken waren in
diese Auseinandersetzung hineingezogen und über dem Macht- und Abrundungsstreben
der beiden benachbarten Fürsten in schwere Bedrängnis geraten. Die Wahl von 2
Wittelsbachern im 14. und 15. Jahrhundert zum Kaiser, deren Anhänger die
Schenken wurden, brachte eine günstige Wendung für sie auch in der Politik der
Pfalzgrafschaft. 1328 verlieh Kaiser Ludwig der Bayer dem Schenken Konrad II.
als Anerkennung seiner Treue im Dienste des Reiches Stadtrechte für Beerfelden.
Da sich die Zentschöffen gegen den Bau einer Stadtmauer wehrten, blieb
Freienstein die bewährte Schutzburg. Sie war besonders im 16. Jahrhundert ein
Bindeglied der guten Beziehungen zwischen Kurpfalz und der Grafschaft Erbach.
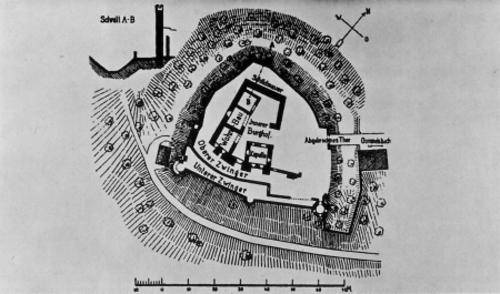
Das kleine Schloss
bildete den Schauplatz regen Lebens durch jährliche Jagdaufenthalte und längeres
Wohnen des Landesherren mit Gefolge. Im 30-jährigen Krieg erlitt es bei starken
Truppendurchzügen mehrfacher Beraubung. Um 1800 war die einstige Glanzzeit in
Vergessenheit geraten, der spärlich bewohnte Zustand näherte sich dem eines
Armenhauses.
Der große Brand von Beerfelden, der 1810 fast 200 Wohnhäuser vernichtete,
veranlasste den Grafen Albert zu Erbach-Fürstenau, den Obdachlosen die
Dachziegel und das Bauholz der Burg für Behelfsbauten zu überlassen. Die
verlassene Ruine wurde ein Wahrzeichen des Gammelsbachtales und ein Wanderziel.
Sie steht unter Denkmalschutz.
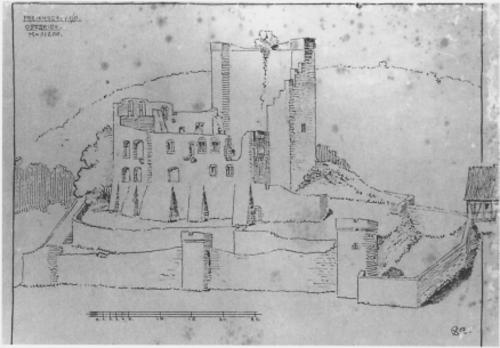
Ansicht Burg Freienstein von Südosten. Bauaufnahme Carl Krauß vom
Anfang des 20. Jahrhunderts,
Gräflich-Erbach-Fürstenauisches Archiv.
Baubestand
Ein tiefer hufeisenförmiger Halsgraben und die hohe Schildmauer sind die
wesentlichen Wehranlagen der auf einem Felssporn stehenden gotischen Hangburg.
Den fehlenden Bergfried ersetzte eine Wehrplatte auf dem bergseitigen Teil der
Schildmauer. Sie ist in stumpfem Winkel zum Burgweg hin abgeknickt. Wo der kurze
abgetreppte Schenkel der Schildmauer mit einem eingezogenen Pfeiler endet,
schloss das innere Tor an. Es saß in einer Sperrmauer zwischen dem
Schildmauerkopf und dem Kapellenbau, der die Südostecke der Kernburg bildet. Er
war ein dreigeschossiger Wohnturm mit quadratischem Grundriss und enthielt die
tornahe St. Nikolauskapelle, deren Kapläne 1457 bis 1521 bezeugt sind. Nach
seinen verschiedenartigen Tür- und Fenstergewänden erfuhr der Kapellenbau im
14., 15. und 16. Jahrhundert Umbauten. Die Jahreszahl 1513 und 2 etwas jüngere
Erker des obersten Geschosses kennzeichnen die bevorzugte Benutzung dieses
Bauteils in der Renaissancezeit. An der Hofseite soll ein gotisches Steinrelief
des Gekreuzigten gewesen sein.
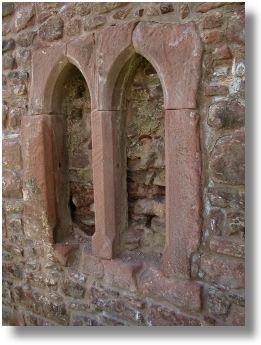
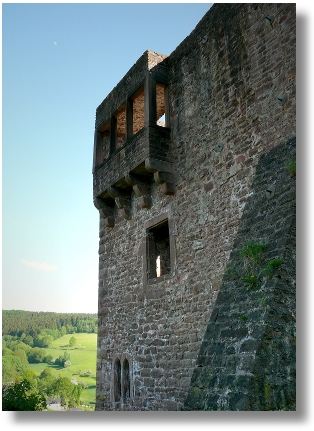
An die lange Westmauer des Innenhofs lehnte sich ein viergeschossiger Baukörper
an, der Palas, vor dem Abbruch Saalbau genannt. Die Palasmauer ist mit der
Schildmauer verbunden und wurde von ihr erheblich überragt, um das hohe Dach zu
schützen. Dieser große Wohnbau war teilweise unterkellert und durch
Zwischenmauern in drei Abschnitte aufgeteilt. In der Mitte hatte er ein schönes
gotisches Portal mit dem Wappenstein, der jetzt an dem Pfeiler der Schildmauer
eingemauert ist (Federzeichnung von Christian Kehrer um 1820). Der kleinste Raum
war die Burgküche. Sie berührte die Schildmauer nicht, sondern war von ihr durch
einen keilförmigen Zwickel getrennt. Vor der einstigen Küche liegt im Hof ein
verschütteter Ziehbrunnen. Zwischen der Kapelle und dem Palas war die überdachte
Holztreppe beider Gebäude. Der Palas enthielt die Hofstube und einen Saal,
wahrscheinlich war ihm außer der Küche auch die Gesindestube eingegliedert.
Unter dem großen Dach war ein Fruchtboden. Die Reiterstube ist am besten im
Kapellenbau vorstellbar. Die Kernburg war an dem Rand des Halsgrabens an drei
Seiten von dem oberen Zwinger umgeben, dessen Mauerzug nur noch in Resten an der
West- und Nordseite erhalten ist. Er weitete sich in dem Eingangsbereich zu
einer kleinen Vorburg. Ihre Bebauung mit Pferdestall und Schmiede, Wagenhalle,
Geräteschuppen und Backhaus ist nicht mehr erkennbar, der Standort des Torhauses
durch ein Grabungsergebnis bekannt. Das Torhaus mit Wächterstube sprang aus der
Flucht der Zwingermauer vor und enthielt das Außentor mit Zugbrücke. Davor war
ein Zufahrtssteg im Burggraben.
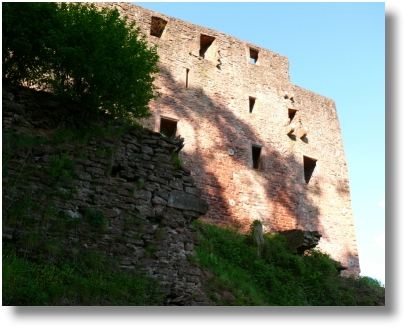

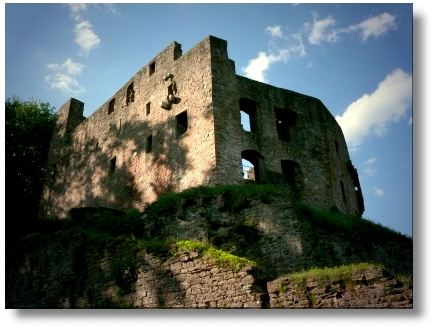

Der mittlere Zwinger
liegt am talseitigen Böschungsfuß der Kernburg, deren Ringmauer dort von
Strebepfeilern gestützt ist. Unterhalb der Vorburgfläche springt ein Mauerstück
mit Pforte vor. Die Fortsetzung der mittleren Zwingermauer berührt den
Gefängnisturm, die runde Eckbastion am östlichen Ende des unteren Zwingers,
winkelte am Grabenrand ab und lief an ihm aufwärts bis zu dem äußeren
Brückentor. So zog sich der mittlere Zwinger um die östliche Ecke der Vorburg.
Der untere Zwinger ist die breite Befestigung der talseitigen Burgflanke aus der
Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Zwingermauer ist zwischen dem Gefängnisturm im
Osten und einem Schalenturm an der Südecke der Burganlage ausgespannt mit
leichtem Knick an einem schwächeren mittleren Schalenturm. Von der Südecke aus
greift die abgewinkelte Zwingermauer noch um den mittleren Zwinger bis an die
südwestliche Begrenzung des oberen Zwingers. Mit seinen drei Wehrtürmen erhebt
sich die lang gestreckte Mitte des unteren Zwingers über einer Gartenterrasse.
Von dem Gefängnisturm ging noch eine Umfassungsmauer um das untere Grabende bis
hinauf an das äußere Auflager des Zufahrtssteges.
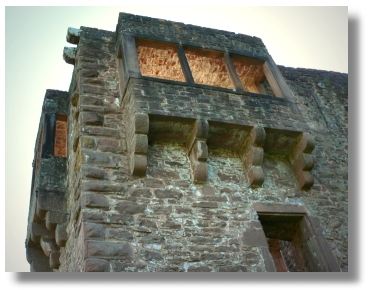
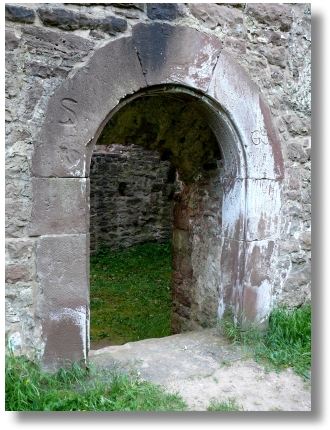
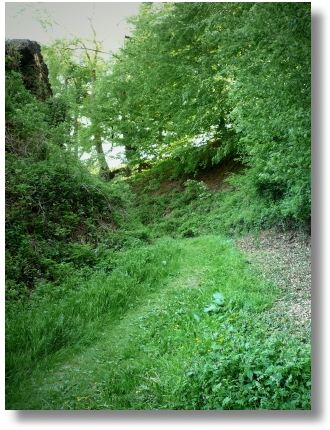

Erhaltungsmaßnahmen
Nach mehrmaligem Besitzwechsel innerhalb des Hauses Erbach (1503, 1531, 1544)
erfolgte um 1550 eine gründliche Instandsetzung. Sie führte nicht zum Verzicht
auf die mittelalterliche Wehrhaftigkeit, förderte aber die neue Eigenschaft des
Wohnschlosses. Dabei war ein welscher Maurer tätig. Die Burgmauern bekamen einen
rauen Verputz, die Ecksteine und Fenstergelände wurden rot angestrichen.
1731 waren Ausbesserungen erforderlich, im restlichen 18. Jahrhundert
notdürftige Bauunterhaltungen. Der Verlust der Dächer wirkte sich für die Ruine
verhängnisvoll aus, weil das Mauerinnere fast nur aus Sand besteht. Ohne festen
Mörtel konnten die durchfeuchteten Mauern bei Frost nicht stabil bleiben. Gegen
1890 wurde an der Innenseite der geborstenen Schildmauer ein Zuganker aus
Eisenrohren angebracht und die südliche und westliche Mauerkrone unter Aufsetzen
von Zinnen gefestigt. 1938 begegnete man der Einsturzgefahr bei der Schildmauer
durch Verringerung ihrer Höhe um etwa 3 m und eine Zementmörtelabdeckung. Diese
war nach einem Jahrzehnt zersprungen und durch Baumbewuchs wirkungslos geworden.
In mehreren Jahresabschnitten wurden die wichtigsten Mauerkronen der Kernburg und
des unteren Zwingers ohne die falschen Zinnenreihen gesichert. Zu den
Rückständen gehört die Schutträumung im Innenhof, dessen Pflaster freigelegt
werden sollte.
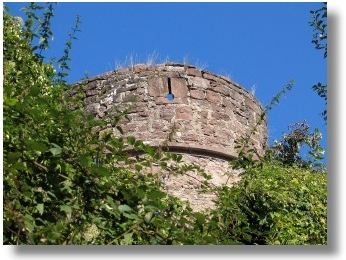



Zusammengetragen nach
verschiedenen Literaturvorlagen durch Dr. O. Müller im Jahre 1978.
Ergänzung des
Verkehrsbüros "Beerfelder Land":
Im Mai 1987 trat der erste Mauerausbruch an der Schildmauer ein. Im März 1988
stürzte dann fast die gesamte, kurz vorher ausgebesserten Schildmauer ein. Dabei
wurde auch der vorgenannte Wappenstein unter den Trümmern begraben.
Seit 1990 werden die Mauern der Burgruine saniert. Die Kosten hierfür werden von
der Stadt Beerfelden, dem Odenwaldkreis und dem Land Hessen getragen.
Fotos - Rug
|
 |
Video Burgruine "Freienstein" |
Sagen
Wie um viele Burgen und Schlösser, rankt sich auch um die
Burg Freienstein ein Kranz von
Erzählungen und Sagen.

Die feurigen Wagen
Konrad Schäfer aus Gammelsbach erzählte: »Ich habe vor
einigen Jahren Frucht auf der Hirschhörnerhöhe nicht weit von Freienstein, dem
alten Schloss, gehütet. Nachts um zwölfe begegneten mir zwei feurige Kutschen mit
grässlichem Gerassel; jede mit vier feurigen Rossen bespannt. Der Zug kam gerade
vom Freienstein. Er ist mir öfter begegnet und hat mich jedes Mal gewaltig
erschreckt; denn es saßen Leute in den Kutschen, denen die Flamme aus Maul und
Augen schlug.«
Kommentar: Mündlich aus
dem Odenwald.
Quelle: Deutsche Sagen, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm (Brüder Grimm), Kassel
1816/18, Nr. 277
Der wilde Jäger
Wenn zur Herbstzeit der Sturmwind über die Berge braust
und die welken Blätter von den Bäumen fegt, zieht der wilde Jäger mit
Büchsengeknall, Hundegeheul und Hörnerblasen durch den Odenwald. In der Burg
Freienstein macht er Halt und es wird von einer gespenstigen Gestalt berichtet,
die ohne Kopf dem wilden Heer voraus zieht.
Wohl eine Erinnerung an Wotan den
germanischen Totengott.
Der Schatz der Burg Freienstein
In den Verließen der Burg soll ein riesiger Schatz
vergraben sein, der aber von zwei grausigen schwarzen Hunden mit Augen "so groß
wie Wagenräder" bewacht wird, die jeden verschlingen, der versucht den Schatz zu
heben.
Sage vom goldenen Kalb
Der Sage nach haben sich in schon christlicher Zeit die
Burgleute, ohne Wissen der Burgherren, wieder dem heidnischen Glauben
zugewendet. Als Götzen machten sie sich ein goldenes Kalb, das sie in einem
unterirdischen Raum anbeteten. Als dies der Burgherr erfuhr, hatte er seine
Untertanen schwer bestraft und das goldene Kalb tief in einen unterirdischen
Raum vergraben.
|